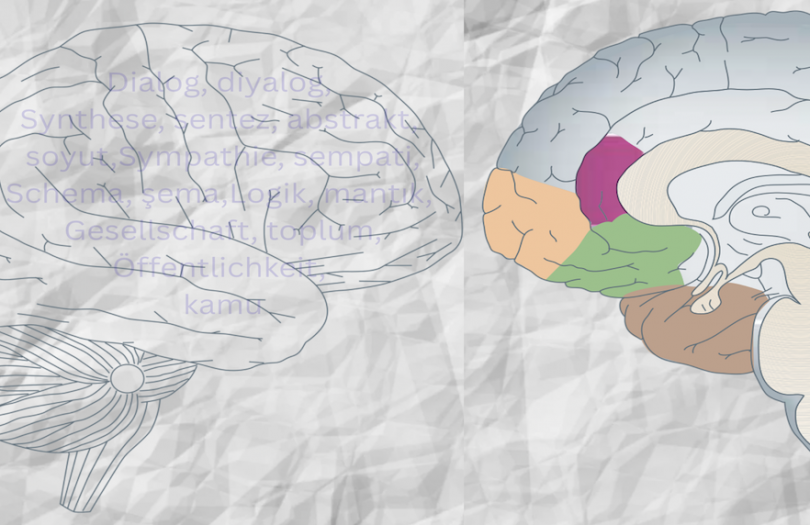Wir sind im Türkischunterricht. Es wird das Schattenspiel von Hacivat und Karagöz behandelt. Eine der Aufgaben für Achtklässler lautet: „Vervollständigen Sie den Dialog zwischen Hacivat und Karagöz mit euren eigenen Sätzen.“ Der folgende Dialog zwischen dem Lehrer und einer Schülerin während der Korrektur der Hausaufgaben ist der Grund für diesen Beitrag:
Melek: Ich habe meine Hausaufgaben nicht machen können, Herr Balken.
Lehrer: Warum?
Melek: Ich habe die Frage nicht verstanden.
Lehrer: Was hast du nicht verstanden?
Melek: Das Wort „Dialog“ …
Lehrer: Hast du es noch nie gehört? Eigentlich solltest du es doch kennen, oder?
Melek: Ich habe es ein paar Mal gehört, aber ich habe die Bedeutung vergessen, ich weiß es nicht mehr.
Lehrer: Anscheinend hast du das Wort nicht richtig gelernt.
Melek: …
Wir stehen vor einem Sprachproblem, das in den letzten Jahren unter Jugendlichen immer häufiger auftritt. Meleks Fall ist ein Beispiel dafür. Die Auswirkungen der Digitalisierung oder der sozialen Medien auf Jugendliche werden häufig diskutiert. Es scheint, dass mit dem Einzug von TikTok und ähnlichen Plattformen in unser Leben unsere Sprachkenntnisse und -fähigkeiten langsam nachlassen. Junge Menschen haben nun eine neue „virtuelle Heimat” jenseits der realen Welt. Denn dort verbringen sie einen Großteil ihrer Zeit. Es ist eine Realität, die weit entfernt ist von zwischenmenschlichen Beziehungen, dem Gebrauch der Sprache in verschiedenen Bereichen, dem Lesen von Büchern, dem Analysieren und dem Nachdenken. In einem solchen Umfeld ist es unvermeidlich, dass die Sprache grundlegend verkümmert.
Wie ist aus soziopsychologischer Sicht eine gesunde Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung in einem solchen Zeitalter möglich? Vor allem, wenn der Wortschatz von Tag zu Tag weiter schrumpft… Wenn Lesen und Schreiben langsam der Vergangenheit angehören… Die verbleibende verkümmerte Sprache zeigt ihre tragischsten Auswirkungen beim Ausdruck von Gefühlen und Gedanken. Sprachwissenschaftler und Philosophen betonen nicht umsonst den engen Zusammenhang zwischen Denken und Sprache. Der Verfall der Sprache bedroht nicht nur die individuelle Kommunikation, sondern auch den sozialen Frieden. Aus diesem Grund stellen viele Länder erhebliche Mittel bereit, um den Unterricht in der Muttersprache zu stärken.
Ich möchte auf zwei grundlegende Probleme aufmerksam machen: Erstens, dass viele Schüler nicht in der Lage sind, mit abstrakten Begriffen zu denken und Synthesen zu bilden, und zweitens, dass ihr Wortschatz oberflächlich ist. Dazu kommt noch ein dritter Punkt: der gemischte Sprachgebrauch türkischer Kinder, die in Europa aufwachsen. Oftmals vermischen sich die Sätze, wenn sie sich an jemanden wenden, der beide Sprachen beherrscht:
- Arbeit’larımızı kriegen yapacak mıyız? (Werden wir unsere Klassenarbeit bekommen?)
- Heft’imi sınıfta unuttum. (Ich habe mein Heft im Klassenzimmer vergessen).
Kinder, die Türkisch nur auf Alltagssprachebene beherrschen, geraten mit solchen gemischten Sätzen ins Stocken, wenn ihre Gesprächspartner weder Deutsch noch Türkisch sprechen. Wenn sie weder die Sprache ihres Wohnsitzlandes noch Türkisch ausreichend beherrschen, verwenden sie eine gemischte Sprache und ihr Wortschatz verarmt. Dies führt zu einem oberflächlichen und ineffektiven Sprachgebrauch.
Der scheinbare Wortschatz ist eigentlich ein Thema, das bisher kaum Beachtung gefunden hat. Aufgrund meiner Beobachtungen kann ich sagen, dass die Schüler einen Wortschatz haben, der voller Wörter ist, deren Bedeutung sie nicht kennen, die ihnen aber bekannt vorkommen. Diese Wörter werden zwar gehört, aber da sie nicht verinnerlicht werden, verwandeln sie sich in vage Ausdrücke, die keine Entsprechung im Kopf haben. So ist der Satz „Ich habe dieses Wort gehört, aber ich kenne seine Bedeutung nicht” immer häufiger zu hören. Dabei hätten Kinder in ihrem Alter altersgerechte Begriffe lernen müssen. Andernfalls bilden Wörter, deren Bedeutung sie nicht kennen, nur einen scheinbaren Wortschatz. Sie bleiben vielleicht im Gedächtnis haften, haben aber keine Funktion beim Ausdrücken von Gefühlen und Gedanken.
Dialog, Synthese, abstrakt, Sympathie, Schema, Logik, Stadt, Gesellschaft, Öffentlichkeit… Das sind Wörter, die in Lehrbüchern vorkommen und von Lehrern häufig verwendet werden. Wenn diese Wörter jedoch in den Köpfen der Schüler keine Assoziationen hervorrufen, kann man von „Worthülsen” sprechen. Auf diese Weise verwandelt sich der ohnehin schon schwache Wortschatz in einen scheinbar umfangreichen, aber inhaltsleeren Wortschatz.
Beispielsweise kommt das Wort „Synthese” in den Themen der 9. Klasse häufig vor. Es wird erklärt und kommt in Hausaufgaben vor. Wenn der Schüler jedoch in diesem Moment nicht aufmerksam ist und dem Unterricht nicht mit dem Kopf folgt, bleibt das Wort „Synthese” zwar im Gedächtnis haften, aber sein Inhalt setzt sich nicht fest. Begriffe lassen sich nicht mit Halbwissen lernen; sie erfordern geistige Anstrengung und müssen im Kontext verstanden werden. Über einen unverständlichen Begriff kann man nachdenken, den Lehrer fragen oder im Internet recherchieren. Dank künstlicher Intelligenz ist es heute einfacher denn je, an Informationen zu gelangen. Aber diese Erleichterung nützt nichts, wenn sie nicht genutzt wird. Jeder Begriff, dessen Bedeutung nicht verinnerlicht wird, bleibt mit der Zeit nur ein „Name”, dessen Bedeutung und Kontext verloren gehen. Was der Körper für die Seele ist, das ist die Bedeutung für die Wörter. Jeder Begriff, dessen Bedeutung nicht verinnerlicht wird, wird mit der Zeit nur zu einem ‚Namen’, also zu einer Leiche, der die Seele entzogen wurde.
Dieser tragische Zustand wird bei vielen Schülern zunehmend deutlicher. Dafür lassen sich viele Gründe aufzählen: dass die Schüler das Lesen meiden, keine Wörterbucharbeit machen, kein Interesse an den Begriffen in den Lehrbüchern zeigen… Ohne ein echtes Sprachbewusstsein zu entwickeln wird es nicht nur schwierig, den Lehrer und den Unterricht zu verstehen, sondern auch, soziale und psychologische Probleme zu bewältigen. Junge Menschen greifen daher zum einfachen Weg und nutzen Slogans, um eine stärkere religiöse oder nationale Identität zu betonen.
Unter Jugendlichen gibt es beinahe eine reflexartige Abwehrhaltung gegenüber dem Lesen von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen. Das verengt ihre Gedankenwelt. Die Dürftigkeit ihres Wortschatzes und die mangelnde Entwicklung ihrer Fähigkeit zum abstrakten Denken stehen damit in direktem Zusammenhang. Aufmerksamkeitsstörungen, Ziel- und Planlosigkeit, digitale Abhängigkeit und mangelnde Teilnahme an sozialen Aktivitäten wirken sich ebenfalls negativ auf die Sprachentwicklung aus.
Da wir jedoch mit Begriffen und Wörtern denken können, entwickelt sich die Vorstellungskraft, das Denkvermögen und die Urteilsfähigkeit umso mehr, je reicher der Wortschatz ist. Ja, selbst die Art und Weise, wie ein Mensch die Welt betrachtet, wird davon geprägt.
Wie lässt sich also ein oberflächlicher Wortschatz in einen aktiven, starken Wortschatz verwandeln? Zunächst kann man den ersten Schritt tun, indem man sich intensiver mit den Begriffen in den Schulbüchern beschäftigt und sie mitsamt ihren Kontexten lernt, sowie indem man Wörterbucharbeit zur Gewohnheit macht. Denn eine Sprache, die ohne Lesen gelernt wird, kann das Niveau der Alltagssprache nicht überschreiten. Für Kinder in der Diaspora ist dies von besonderer Bedeutung. Denn dass sich Wörter im Geist festsetzen, ihre Bedeutungen gefestigt werden und ihre Verwendung in unterschiedlichen Kontexten sichtbar wird, ist nur durch das Lesen möglich. Ob im Fernsehen oder in Videos – die tausenden Wörter, die über Bildschirme kommen und gehen, ziehen vorüber, ohne dass man sich meist überhaupt mit ihnen auseinandersetzt. Im Buch hingegen unterstreichen wir Wörter, lesen erneut, recherchieren unbekannte Wörter und denken über sie nach.
Ein gewisses Maß an oberflächlichem Wortschatz besitzt selbstverständlich jede Schülerin und jeder Schüler. Wichtig ist jedoch, das Anwachsen eines solchen ausgehöhlten Wortschatzes zu verhindern. Der vorliegende Text stützt sich nicht auf eine empirische Untersuchung, sondern auf meine langjährigen Beobachtungen. Diese werden allerdings von mehreren Fachleuten auf diesem Gebiet bestätigt. Hoffen wir, dass dieses Thema künftig noch eingehender erforscht wird und sich im zerstörerischen Schatten der sozialen Medien ein neues Sprachbewusstsein entwickelt.
Muhammet Mertek